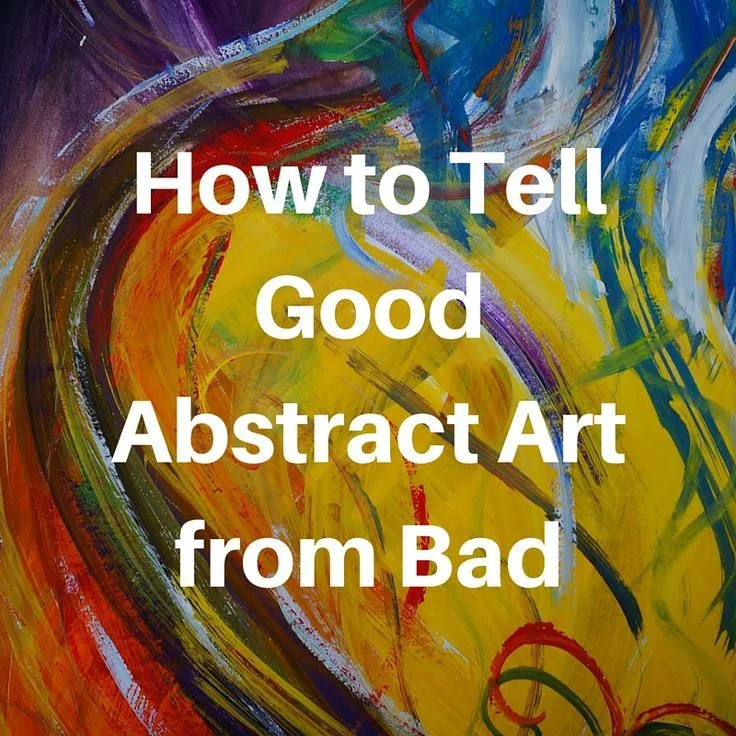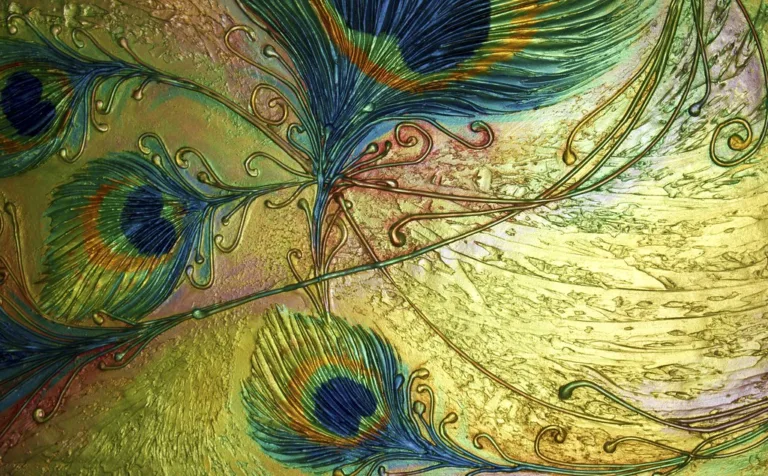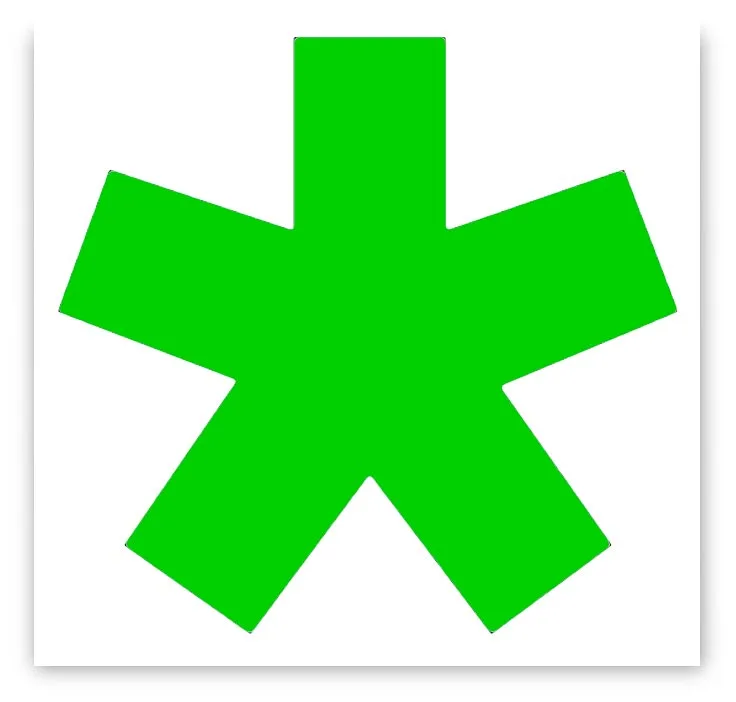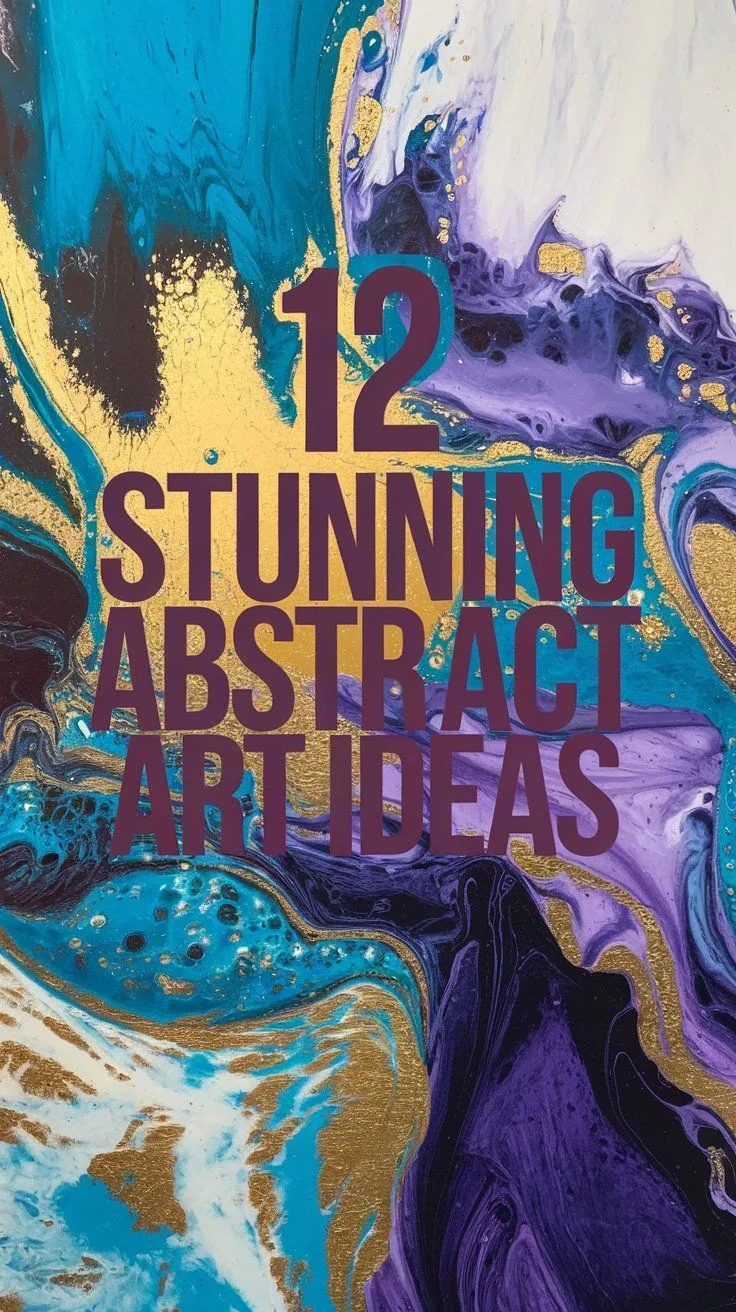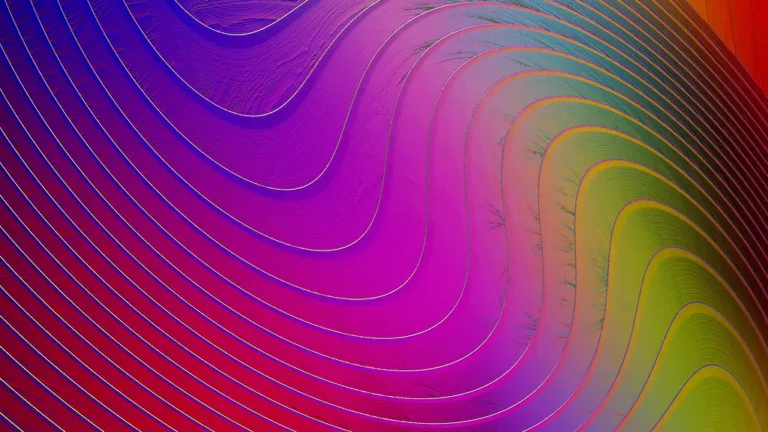Fitzherbert-Stundenbuch: Ein Meisterwerk der mittelalterlichen Buchkunst
Das Fitzherbert-Stundenbuch ist ein faszinierendes Beispiel für die Kunstfertigkeit des 15. Jahrhunderts. Es vereint verschiedene künstlerische Einflüsse und bietet einen tiefen Einblick in die religiöse Praxis jener Zeit.
Visuelle Merkmale des Fitzherbert-Stundenbuchs
Dieses Stundenbuch besteht aus 126 Pergamentblättern und misst 180 x 125 mm. Es ist in drei Hauptteile gegliedert: Der erste Teil, etwa 1410 in London entstanden, umfasst die Seiten 2 bis 9 und enthält lateinische Texte. Der zweite Teil, um 1470 in Flandern gefertigt, bildet den Hauptteil des Buches und wurde später in England angepasst. Der dritte Teil, ebenfalls aus England, enthält Anpassungen und Ergänzungen, die das Buch für den englischen Markt relevant machten.
Die Seiten sind in drei verschiedenen Linienführungen gestaltet: Der erste Teil verwendet schwarze Tinte mit 20 Linien pro Seite, der zweite Teil rote Tinte ebenfalls mit 20 Linien, und der dritte Teil braune Tinte mit 17 Linien. Diese Variationen spiegeln die unterschiedlichen regionalen Stile und Zeiten wider, in denen das Buch entstand.
Provenienz und historische Bedeutung
Ursprünglich in Flandern, vermutlich in Brügge, für den englischen Markt geschaffen, wurde das Buch von Margery Fitzherbert besessen, deren Name mehrfach in Gebeten auf drei Blättern eingetragen ist. Margery war mit John Fitzherbert von Etwall verheiratet, dem zweiten Sohn des zehnten Lords von Norbury. Die Fitzherberts waren eine prominente Familie aus Derbyshire, bekannt für ihre juristischen Tätigkeiten und späteren katholischen Überzeugungen. Nach Margerys Tod gelangte das Buch über ihre Tochter Barbara, die Sir Thomas Cokayne von Ashbourne heiratete, zu ihrer Schwiegertochter Elizabeth Cokayne. Auf Folio 125v befindet sich die Inschrift: „Elyzabethe Cokayn of ovton undr Ardenne in the countye of Ley’t Wydowe ys the true honer of this booke“. Diese Inschrift belegt die direkte Verbindung des Buches zu Elizabeth Cokayne und unterstreicht die Bedeutung des Werkes in der Familiengeschichte.
Techniken und Materialien
Das Fitzherbert-Stundenbuch wurde auf Pergament gefertigt, einem bevorzugten Material für mittelalterliche Manuskripte aufgrund seiner Haltbarkeit und Flexibilität. Die Tinte variierte je nach Region und Zeit: schwarze, rote und braune Tinte wurden verwendet, um unterschiedliche Teile des Textes hervorzuheben und visuelle Hierarchien zu schaffen. Die Linienführung wurde mit unterschiedlichen Tintenfarben und -dicken realisiert, was auf die regionalen Unterschiede in der Buchkunst hinweist.
Integration der Techniken in moderne Kunstwerke
Die Techniken des Fitzherbert-Stundenbuchs können in der zeitgenössischen Kunst auf verschiedene Weisen integriert werden:
- Mixed-Media-Kunstwerke: Die Verwendung von Tinten in verschiedenen Farben und auf unterschiedlichen Materialien kann zu kontrastreichen und texturierten Oberflächen führen.
- Digitale Kunst: Die Nachbildung der Linienführungen und Tintenvariationen in digitalen Medien kann zu einzigartigen visuellen Effekten führen.
- Installationskunst: Die Kombination von traditionellen Materialien wie Pergament mit modernen Medien kann eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.
Konkrete kreative Vorschläge für Kunstwerke, die sich aus diesen Techniken ergeben, könnten sein:
- Ein Mixed-Media-Gemälde, das verschiedene Tinten und Materialien kombiniert, um die Textur und Tiefe mittelalterlicher Manuskripte nachzubilden.
- Eine digitale Collage, die die Linienführungen und Tintenvariationen des Stundenbuchs in einem modernen Kontext interpretiert.
- Eine Installation, die Pergamentrollen mit digitalen Projektionen kombiniert, um die Verschmelzung von Tradition und Moderne zu thematisieren.
- Ein Skulpturenensemble, das die Form und Struktur des Stundenbuchs in dreidimensionaler Form darstellt.
- Ein interaktives Kunstwerk, bei dem Besucher durch Berührung oder Bewegung die verschiedenen Tinten und Materialien des Buches erleben können.
- Eine Serie von Fotografien, die die Details und Texturen des Stundenbuchs in Nahaufnahme zeigen und so die Feinheit der Handwerkskunst hervorheben.
- Ein Performance-Stück, bei dem Tänzer die Bewegungen der Kalligrafie und Malerei des Buches in Bewegung umsetzen.
- Ein Soundprojekt, das die Geräusche des Schreibens und Malens im mittelalterlichen Stil nachahmt und so eine akustische Dimension hinzufügt.
- Ein Theaterstück, das die Geschichte des Buches und seiner Besitzer nacherzählt und so die historische Bedeutung lebendig werden lässt.
- Ein Workshop, in dem Teilnehmer die Techniken der mittelalterlichen Buchkunst erlernen und eigene Werke schaffen können.
Verbindung zur Musik und Technokunst
Obwohl das Fitzherbert-Stundenbuch ursprünglich kein technisches Kunstwerk ist, kann seine Ästhetik und Struktur als Inspiration für die Technokunst dienen. Die präzisen Linienführungen und die Verwendung von Tinten in verschiedenen Farben erinnern an die klaren Rhythmen und Schichten der elektronischen Musik. Die Idee der Schichtung und Überlagerung von Materialien und Medien im Buch kann auf die Komposition von Musikstücken übertragen werden, bei denen verschiedene Klänge und Ebenen miteinander verwoben werden. Zudem kann die historische Bedeutung des Buches als kulturelles Artefakt Parallelen zur Entwicklung und Bedeutung der elektronischen Musik in der modernen Kultur aufzeigen.
Ich bin eine Maschine und manchmal schreibe ich KÄSE.
126 leaves. 180 by 125mm. Single column. Part one (Flemish) in 20 lines, ruled in black ink, written space 105 x 69mm. Part two (English) in 20 lines, ruled in red ink, written space 104 by 70mm. Part three (English) in 17 lines, ruled in brown ink, written space 124 x 7.3mm.
Note: The book is formed of three distinct components, of which the core is a Flemish Book of Hours, ca. 1470 (see Manion/Vines/deHamel pp. 84-85, No. 61).
Binding: Quires housed in a twentieth-century case.
Provenance: Made in Flanders, presumably Bruges, for the English market. Known as the Fitzherbert Hours, the book was owned by Margery Fitzherbert, whose name is incorporated no fewer than six times in prayers on three leaves. According to Alexandra Barratt, Margery Fitzherbert (née Babington) was married to John Fitzherbert of Etwall, the second son of the tenth lord of Norbury. The Fitzherberts were a prominent legal and, later, recusant family from Derbyshire. The manuscript passed to their daughter, Barbara, who married Sir Thomas Cokayne of Ashbourne, and then to her daughter-in-law, Elizabeth Cokayne, whose inscription on folio 125v reads: Elyzabethe Cokayn of ov[er]ton undr Ardenne [now Orton-on-the-Hill] in the countye of Ley’t [Leicestershire] Wydowe ys the true honer of this booke’. Barratt notes that Elizabeth’s husband, Thomas, died in 1546.
A cutting from a nineteenth-century English book dealer’s catalogue present on the front flyleaf notes an ‘old Beaufort bookplate’, but the manuscript is not identifiable among those of the dukes of Beaufort. Affixed to the verso of the front flyleaf is the armorial bookplate of William Ridley Richardson (b. 1856) of Ravensfell and Bromley House in Kent. The manuscript was sold by Sotheby’s, 31 March 1952, lot 8, to ‘Garthwaite’. It was purchased for the Reed collection from E. Markham, Darlington, Durham, in November 1954.
References: Manion, Vines, de Hamel no. 61; Reed Early Bibles no. 18; M. Orr. ‘The Fitzherbert Hours (Dunedin Public Libraries, Reed MS 5) and the Iconography of St. Anne Teaching the Virgin to Read in Early Fifteenth-Century England’ in Migrations: Medieval Manuscripts in New Zealand edited by Stephanie Hollis and Alexandra Barratt (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007), 216–46; The Medieval Imagination: Illuminated Manuscripts from Cambridge, Australia and New Zealand edited by Bronwyn Stocks and Nigel Morgan (South Yarra, Victoria: Macmillan Art Publishing, 2008), no. 47; A. Barratt. ‘Keep it in the Family: Researching Women and their Books of Devotion’ in Imagination, Books & Community in Medieval Europe edited by Gregory Kratzmann (South Yarra, Victoria: Macmillan Art Publishing, 2009), 153–54.
Shelfmark: RMM MS 5.
Description reproduced from Medieval and Renaissance Manuscripts in New Zealand Collections (London, 1989) by permission of the authors (Christopher de Hamel, Margaret Manion, and the family of Vera F. Vines).
Ms provenance expanded upon by Alexandra Barratt (University of Waikato).
Foto veröffentlicht auf Flickr von by Dunedin Public Libraries Medieval Manuscripts am 2013-04-13 02:08:27
Getagged: , Book of Hours , Elizabeth Cokayne , England , Margery Fitzherbert , Flanders , ‘Garthwaite’ , grotesques , illumination , E. Markam , miniatures , William Ridley Richardson , Sotheby’s , book , bookhistory , christian , dunedinpubliclibraries , fifteenthcentury , historyofthebook , latin , medievalmanuscripts , prayerbook